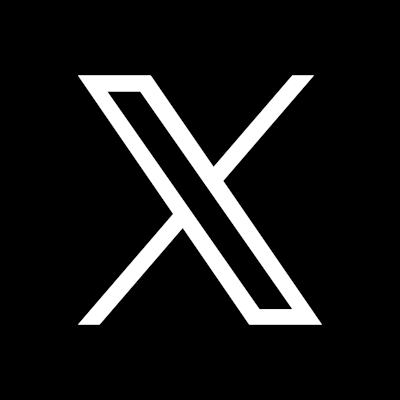Arbeitstreffen
1. Treffen: Humanismuskonzept und Übersetzungstypologie (Frankfurt, 28. Februar 2013 bis 01. März 2013)
Verschiedene Formen humanistischen Übersetzens werden identifiziert und eine Typologie entwickelt. Ergänzt wird diese systematische Differenzierung durch eine diachrone Betrachtungsweise. Die Mitglieder des Netzwerks verständigen sich über das Konzept des Humanismus, über verschiedene Phasen und Formen, insbesondere über den Begriff eines volkssprachlichen Humanismus. Wichtige Indikatoren für die Frage einer Binnengliederung sind die Intensität der Übersetzungstätigkeit in verschiedenen Abschnitten der betrachteten Periode (1450–1620) und die Unterschiede in Übersetzungsstilen zwischen früh-, hoch- (?) und späthumanistischen Übersetzern.
2. Treffen: Historische Semantik (München, 07. November 2013 bis 08. November 2013)
Im Zentrum steht das schwierige, erst auszutarierende Verhältnis von Ausgangs- und Zielsprache, zwischen denen die Übersetzung zu vermitteln sucht. Aufgrund fehlender Terminologie und semantischer Verschiebungen ergibt sich für die humanistischen Autoren die Notwendigkeit, lateinische Worte zu entlehnen oder neue Wendungen zu formen. An exemplarischen Untersuchungen soll gezeigt werden, inwiefern die frühneuzeitlichen Übersetzungen als Katalysator fachsprachlicher Entwicklung vor allem im poetologischen Bereich fungieren. Gerade an solchen Begriffsprägungen lässt sich der Einfluss der humanistischen Antikenübersetzungen auf die Poetiken des Frühbarock nachweisen.
3. Treffen: Poetologische Akzentuierungen (Tübingen, 27. Februar 2014 bis 28. Februar 2014)
Die antiken Autoren gelten den humanistischen Übersetzern als Vorbilder, deren vielseitiges Wissen und kaum überbietbare Eloquenz in die Volkssprache überführt und in ihr nachgeahmt werden sollen. Bei diesem Übertragungsprozess wird die antike Vorlage mit vorhandenen literarischen Maßstäben harmonisiert und aktuellen Gegebenheiten und Vorlieben angepasst. Das humanistische Ideal der imitatio wird dabei zum Antrieb für Veränderungsprozesse in Sprache und Literatur; gleichzeitig wird durch die Rekontextualisierung der übertragenen Texte auch eine Veränderung der Ausgangstexte unumgänglich, die zu signifikanten Verschiebungen führt.
4. Treffen: Literaturkonzept und Poetiktransfer (Basel, 30. Oktober 2014 bis 31. Oktober 2014)
Untersucht wird, inwieweit die Rezeption der antiken Autoren die Produktion neuer literarischer Werke in der Volkssprache ermöglicht oder zu einer grundlegenden Revision und Transformation bereits bekannter Literaturformen führt. Vor allem das epochenspezifische Charakteristikum der aemulatio hat zur Folge, dass sich die humanistischen Autoren von den antiken Vorbildern abgrenzen und eine eigene, spezifisch frühneuzeitliche Poetik entwickeln. Flankierend werden poetische Grundlagentexte aus der Zeit um 1600 herangezogen, um den Einfluss der humanistischen Antikenübersetzungen auf Martin Opitz und seine Nachfolger zu beleuchten.
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity